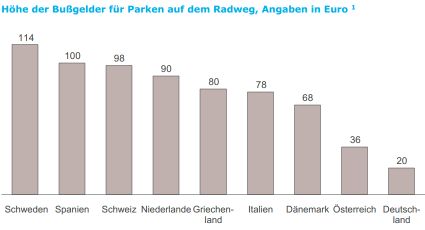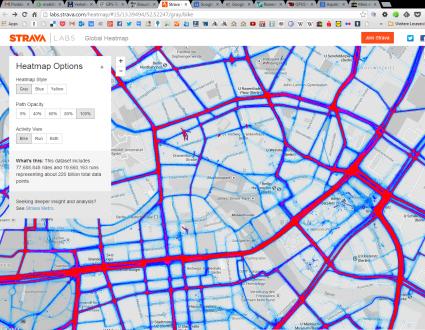Heute, am Dienstag den 17.6.2014 urteilte der Bundesgerichtshof in der Revision zu einem Urteil des OLG Schleswig-Holstein.
In dem beschriebenen Fall wurde einer Radfahrerin, die in einen „dooring“ Unfall verwickelt war, aufgrund fehlenden Fahrradhelmes eine Teilschuld zugesprochen.Es ging mit Hilfe des ADFC in Revision, heute haben wir nun ein Urteil.Im Vorfeld des Revisionsurteils wurde oft von Helmpflicht gesprochen und die entsprechenden Debatten kursierten wild.
Die Presse berichtet :
Die Entscheidung einen Helm zu tragen oder nicht, bleibt also weiterhin jedem selbst überlassen.
Update:
Kernsatz aus der Pressemitteilung des BGH: „Für Radfahrer ist das Tragen eines Schutzhelms nicht vorgeschrieben.“ Einschränkend sagt der BGH, dass einem Geschädigten auch ohne einen Verstoß gegen Vorschriften haftungsrechtlich ein Mitverschulden anzulasten sein kann, wenn das Helmtragen allgemeinem Verkehrsbewusstsein entspricht. Elf Prozent Helmträger unter den Radfahrern sind aber (noch) nicht allgemeines Verkehrsbewusstsein.
BGH: Kein Mitverschulden wegen Nichttragens eines Fahrradhelms